Plötzlich musste sie sich um alles kümmern: Als ihr Mann vor drei Jahren einen Schlaganfall erlitt, wurde er von einem auf den anderen Tag zum Pflegefall. Lange hielt Karina Lehnhardt* das nicht aus. Irgendwann saß sie bei ihrem Arzt und stellte fest, dass sie selbst Hilfe braucht. Daraufhin begann sie eine Psychotherapie, die ihr half, für sich selbst zu sorgen.
2015 hatte ihr Mann einen Schlaganfall. Was passierte danach?
Ich habe ihn anfangs zu Hause gepflegt. An den Werktagen hatte ich morgens einen Pflegedienst im Haus. Mein Mann hatte zudem ein sehr enges Netz an Therapien: Fünf Mal die Woche Lymph-Therapie, fünf Mal die Woche Krankengymnastik, drei Mal die Woche Ergotherapie und einmal die Woche Logopädie. Das waren die Therapien, die er im Krankenhaus bekommen hatte, und weil er privatversichert ist, hatte seine Ärztin ihm das auch so weiter verschrieben.
Sie waren aber selbst auch noch berufstätig in der Zeit?
Ja, ich habe gearbeitet, allerdings nicht Vollzeit: Ich war sieben Stunden pro Woche in einer Grundschule und zehn Stunden bei der Lebenshilfe. In der Zeit, in der mein Mann bei seinen Therapien war, hatte ich die Möglichkeit das Haus zu verlassen. Damals hatte er die Pflegestufe 2, aber erst als mich eine Freundin fast schon drängte, einen Antrag auf eine Neueinstufung durch den MDK (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung, Anm. d. Red.) zu machen, habe ich das auch beantragt. Sie hatte mitbekommen, wie es zu Hause bei uns zuging und wieviel Unterstützung er bei nahezu jedem Handgriff im Alltag brauchte. Er ist dann hochgestuft worden, mittlerweile hat er den Pflegegrad 5.
Das heißt, Sie mussten quasi 24 Stunden dabei sein?
Jein. Ich habe ihn damals, als wir noch keine 24-Stunden-Betreuung hatten, auch schon stundenweise allein gelassen. Er hatte sein Handy bei sich und hätte mich anrufen können, wenn etwas gewesen wäre. Schwierig sind heute vor allem die Phasen, wenn ein Pflegekraftwechsel bevorsteht und wir nicht wissen, wie es weiter geht.
Wie hat sich das auf Sie ausgewirkt?
Ich bin in den Funktionsmodus gewechselt. Es wird dann nicht mehr nachgedacht. Das merke ich an mir genauso wie an anderen, die ihre Angehörigen pflegen.
Wie macht sich dieser „Funktionsmodus“ bemerkbar?
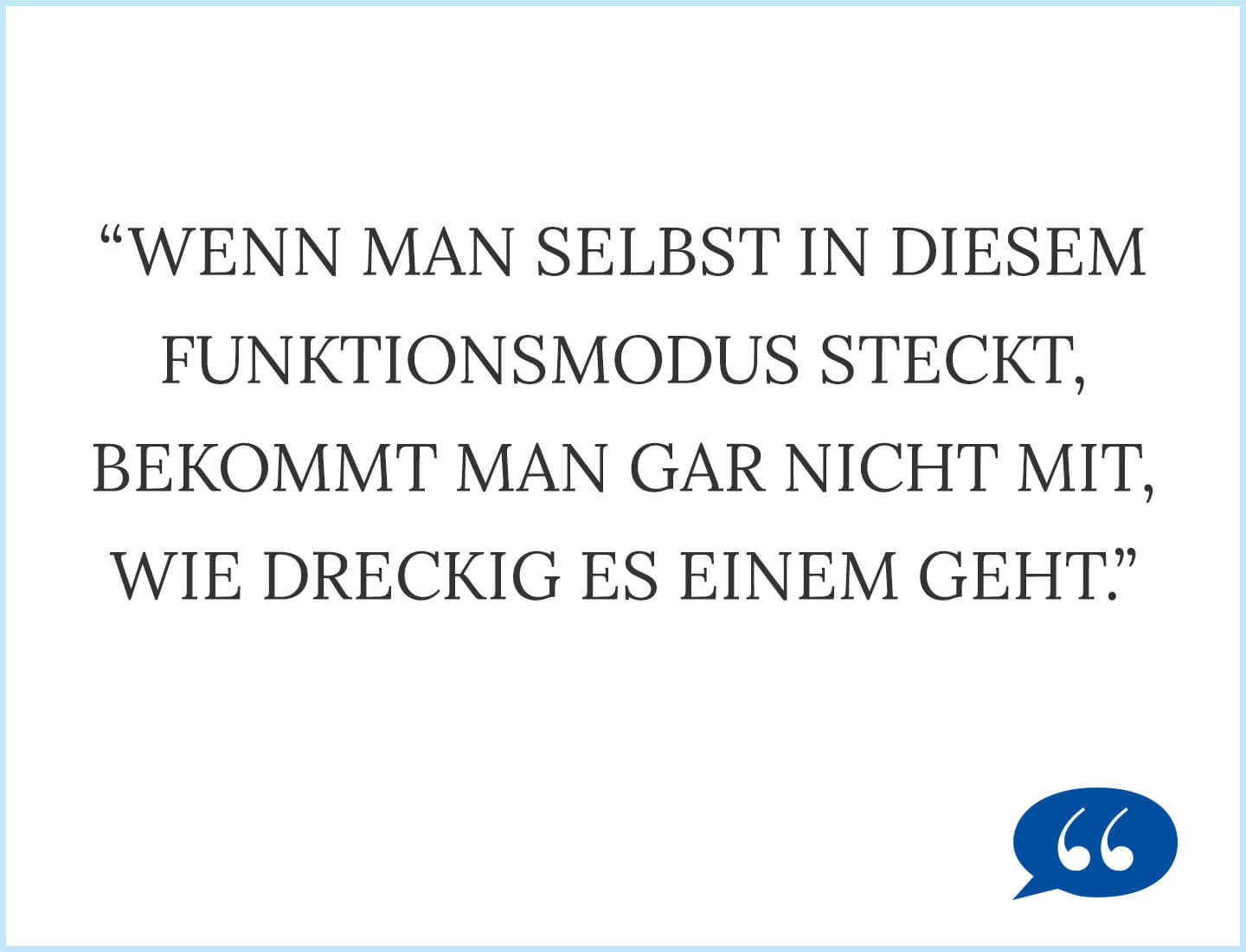
Ist Ihnen das schwer gefallen?
Es geht. Die gerade anwesenden Therapeuten bei meinem Mann werden schon wissen, was zu tun ist. Und wenn irgendetwas Entscheidendes sein sollte: Die 112 kann jeder wählen. Wenn etwas wirklich Schlimmes passieren sollte, kann ich ohnehin nichts machen.
Ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwer ist, das auch wirklich durchzuziehen.
Ja, es war schwer. Aber auf der anderen Seite gehen diese ständige Aufmerksamkeit, diese ständige Erreichbarkeit und dieses ständige Auf-dem-Sprung-Sein sehr an die eigene Substanz. Als ich mitbekommen habe, wie erleichternd es ist, einmal nicht erreichbar zu sein, habe ich gewusst, dass es der richtige Schritt war.
Machen Sie sich trotzdem Sorgen?
Da bin ich relativ rational. Ich habe nach mehreren Erlebnissen mit meinem Mann erkannt, dass etwas, das in ihm Panik auslöst, nicht unbedingt schwerwiegend sein muss. Und er hat die Möglichkeit sich Hilfe zu holen. Es gab Situationen, in denen er wissen wollte, wie weit er mich manipulieren und beherrschen kann. Ich hatte einen Chor-Auftritt und er wollte unbedingt auf dem Sofa sitzen, was er sonst eigentlich nicht macht. Ich habe ihm alles vorbereitet, auch das Essen stand für ihn erreichbar auf dem Tisch. Als bei ihm dann Einiges schief lief, hat er eine unserer Töchter angerufen, die dann mich informiert hat.
Das ist eine Sache, über die wenig bis gar nicht gesprochen wird. Wer manipuliert wen, wer übt Macht aus und was macht das mit einem?
Ja, aber dieser Machtmissbrauch besteht ja auf beiden Seiten. Ich habe ihn auch bevormundet und ertappe mich selbst auch heute noch manchmal dabei, dass ich Sachen für ihn regele, ohne es mit ihm abzusprechen.
Sie haben dann eine Psychotherapie angefangen. Hat die dabei geholfen?
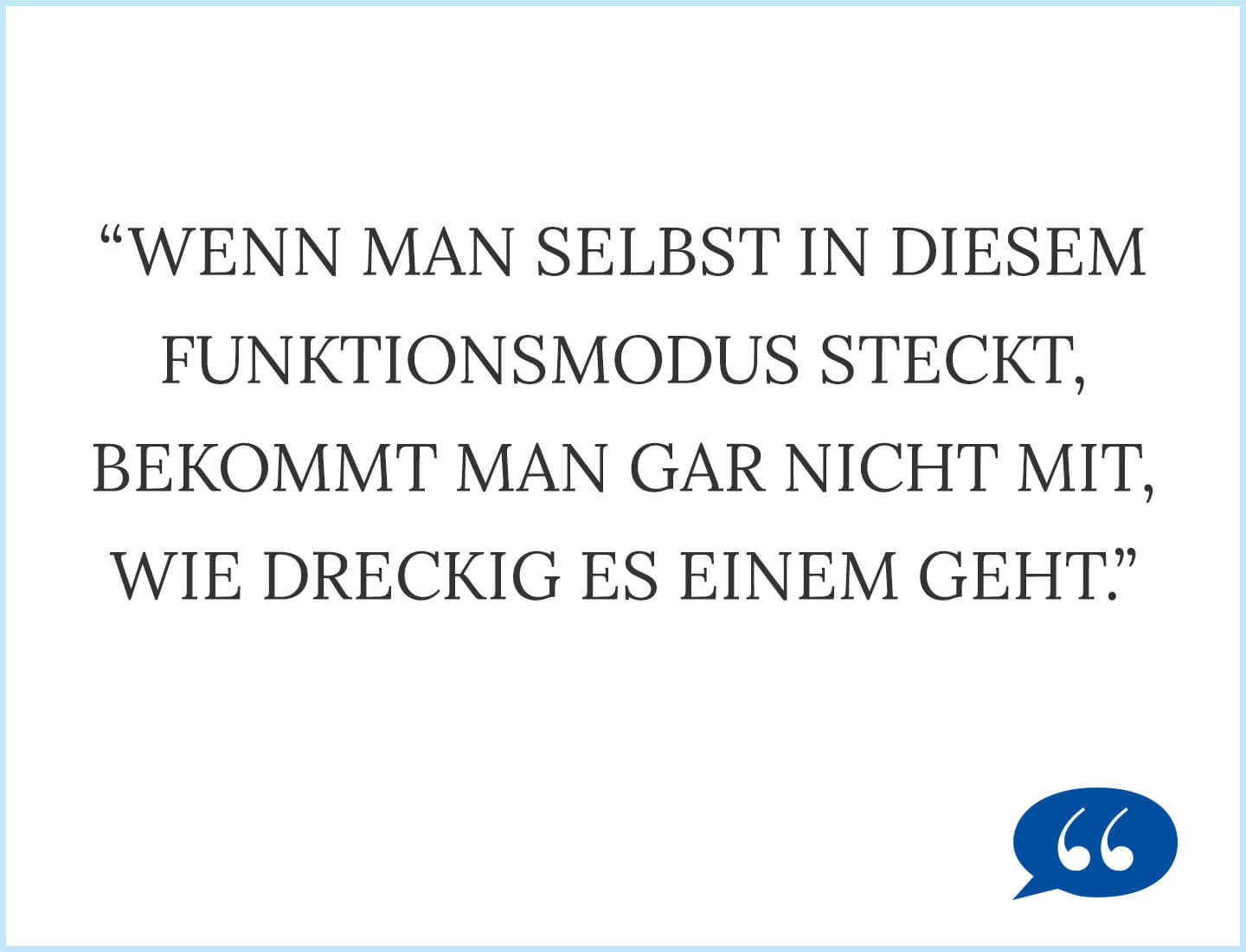
Wie fühlen Sie sich dabei, wenn Sie „Nein“ sagen?
Wenn er dann versucht, unsere Töchter mit den Aufgaben zu betreuen, fühle ich mich schlecht, weil es häufig wirklich nur Sachen von zwei Minuten sind. Aber darum geht es nicht. Ich bin nicht für ihn verfügbar und nein, ich springe nicht, wenn er es will. Es fällt schwer, aber es wird besser.
Außer, dass Sie gelernt haben, Grenzen zu ziehen und sich damit selbst zu schützen: Was ziehen Sie sonst noch für sich aus der Therapie?
Meine Therapeutin hatte mich damals konsequent krankgeschrieben, bis ich in eine Klinik gegangen bin. Ich habe dann dazu geneigt zu sagen, dass es mir schon besser gehe und dass ich eigentlich wieder mit der Arbeit beginnen könne, aber auch da hatte sie klar „Nein“ gesagt. Das war nicht leicht, aber sehr erleichternd, auch mal eine Entscheidung abgeben zu dürfen und in einem kleinen Bereich nicht verantwortlich sein zu müssen.
Gibt es Selbsthilfegruppen von pflegenden Angehörigen, die sich austauschen?
Ich weiß es nicht. Aber als pflegender Angehöriger hast du auch gar keine Zeit, um dich damit zu beschäftigen. Ich bekomme das auch auf meiner Arbeit bei der Lebenshilfe immer wieder mit: Die Informationen kommen häufig nicht an. Sie stehen vielleicht zur Verfügung und vielleicht werden sie sogar per Post zu einem nach Hause geschickt – aber man ist sehr oft einfach nicht in der Lage, sich darum zu kümmern, sich das alles durchzulesen und das Entsprechende für sich herauszusuchen. In dem Funktionsmodus, in dem man sich befindet, kann man darüber nicht nachdenken. Ich habe einmal ein Konzept erarbeitet, wie man damit umgehen könnte. Ich denke, man sollte da bereits beim Hausarzt ansetzen. Da müsste es ein Schreiben geben, in dem pflegende Angehörige dem Hausarzt erlauben Daten und Kontakte an eine neutrale Stelle weiterzuleiten. Die setzen sich dann mit den Betroffenen in Verbindung und sind erst einmal nur für Gespräche da und schauen, wo Bedarf vorhanden ist. Und zwar proaktiv, damit nicht erst die Betroffenen den ersten Schritt machen müssen.
*Name von der Redaktion geändert